Band 4/2 – 2013
urteilen – sprechen – orientieren
– sprechen – orientieren
herausgegeben von Kirstin Zeyer und
Wolfgang Christian Schneider
Inhaltsverzeichnis Buchbesprechungen Vorschau auf das kommende Heft Zu den Autoren Vorwort urteilen- sprechen – orientieren Die Begriffe „urteilen – sprechen – orientieren“ bilden gleichsam die Eckpunkte eines Dreiecks, in dem die Beiträge dieses Heftes der Coincidentia stehen. Den einen Blickpunkt kennzeichnet der Beitrag von Martin Bunte, der die Bedeutung des ästhetischen Ideals in Kants Kritik der Urteilskraft herausarbeitet: Es bildet im Rahmen der kritischen Philosophie tatsächlich eine Gelenkstelle, an der sich die praktische Philosophie und die Ästhetik begegnen. Vom Standpunkt eines umfassend ästhetisch aufgefaßten Sprechens antwortet darauf der Beitrag von Harald Schwaetzer zu Hölderlin, der Kants Ansatz zu einer kritischen Metaphysik im Sinne einer transformierten platonischen Prinzipienlehre zu begründen sucht. Seine Bemühung zielt auf eine Verschmelzung des Objektiv-Mythischen mit dem Subjektiven im Ästhetischen, und das gestaltet er im Gedicht Patmos. So verwundert es nicht, dass darin das im Platonismus gepflegte Denkbild der „Goldenen Kette“ erscheint. Dem Beitrag über die Kritik der Urteilskraft tritt zur Seite der Beitrag von José González Ríos, der erläutert, wie für Ernst Cassirer die Beziehung zwischen der Darstellung und dem Dargestellten, d.h. zwischen dem sprachlich-gedanklichen Symbol und seiner Bedeutung, bei Cusanus diesen als wesentlich für die Entwicklung des modernen Denkens erweist. Dem Erkenntnisproblem verbunden stellt der Beitrag von Claus-Artur Scheier das Sagen, den Logos in den Mittelpunkt und sieht dessen Strukturiertheit im Rahmen eines Denkens, das von Hellas bis hin zu Wittgenstein reicht: Der logos selbst lässt sich nicht abbilden, nicht wirklich fassen, er zeigt sich – wesentlich gerade als Welt; was „abgebildet“, „beschrieben“ werden kann, ist nicht er selbst, sondern das Wie seines Sich-Zeigens. Derselben Spur folgt Thomas Schmaus in seinen Darlegungen zum Verhältnis zwischen Philosophie und Poesie: einer „Verteidigung der Dichtung vor dem Gerichtshof der Philosophie“. Gegen die – auch vom frühen Wittgenstein vertretene – Skepsis gegenüber dem poetischen Sprechen betont er Überlegungen Heideggers, Blumenbergs und Derridas ausziehend, wie die Philosophie von der Dichtung profitiert und auf sie geradezu angewiesen ist als Bedingung der Möglichkeit, Begriffe zu bilden und umzubilden. Die von sprachanalytischer Seite oftmals angeprangerten Unschärfen des poetischen Sprechens dürfen daher nicht voreilig bereinigt oder gar verdammt werden, stellen sie doch anhaltend Fragen, Anstöße, Stoff für das Denken in den Raum. Dem Blickpunkt des Sprechens ganz konkret verpflichtet ist dann die Studie von Ludwig Lehnen, der Heideggers Deutung von Gedichten Stefan Georges behandelt und erläutert, wie unbedingt der Philosoph das Eigene verfolgt, wenn er umfassend dem Wort das Konstitutive zuweist: „daß erst das Wort ein Ding als Ding sein lässt“. Der Aufsatz von Andrea De Santis über das Paradox leitet dann ausdrücklich vom Blickwinkel des Sprechens zu dem des Orientierens über. Denn in der ihm eigenen internen Widersprüchlichkeit erhält das Paradox einen über sich hinausgehenden verweisenden Charakter – wodurch es orientierend wirkt. Diese Sicht verstärkt dann die Studie von Werner Stegmaier, der angesichts des Schwindens allgemein gültiger oberster Werte und absoluter Wahrheiten für eine Philosophie der Orientierung wirbt, womit ein von Moses Mendelssohn und Immanuel Kant in die Philosophie eingeführter Begriff fruchtbar gemacht wird. Dabei kommt dem so häufig als zerstörerisch angeklagten „Relativismus“ eine bedeutsame, tragende Rolle zu. Das konkretisiert der Beitrag von Lars Leeten, der das Moment der Orientierung wesentlich im Handlungsvollzug in den Blick nimmt, wobei auch dem Denken Handlungscharakter zukommt: Da der Einzelne im Urteilen nicht auf allgemein gültige Regeln bauen kann, muss er eigenständig orientierende Instanzen gewinnen – und zwar im Lebensvollzug -, was für ihn eine in das Diskursive und im Pragmatischen eingebettete ethische Verpflichtung bedeutet. Damit tritt die Orientierung in ein Spannungsverhältnis zu dem, was Kant unter dem Begriff des Urteilens zu fassen suchte. Wolfgang Christian Schneider herausgegeben von Wolfgang Christian Schneider Inhaltsverzeichnis Buchbesprechungen Vorschau auf das kommende Heft Zu den Autoren Vorwort CUSANUS: RELIGIONSPHILOSOPHISCHE BEZÜGE Nach dem Heft 1/2 von 2010 über „Cusanus und das Unendliche“ und einzelnen weiteren Aufsätzen zu Cusanus in den folgenden Heften erscheint nun in Coincidentia das zweite ausschliesslich Cusanus gewidmete Heft, in dem die religionsphilosophischen Bezüge Nikolaus‘ von Kues im Mittelpunkt stehen. Ein grösserer Teil der Aufsätze geht auf Vorträge der Tagung „Die Rezeption des Nicolaus Cusanus in der Religionsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts“ in Bernkastel-Kues (vom 3. bis 5. Sept. 2010) gemeinsam mit Forschern der Universität St. Petersburg zurück. In der dortigen philosophischen Fakultät besteht innerhalb des „Centre for medieval culture studies“ eine Forschungsabteilung zu Nikolaus von Kues, die „St.-Petersburg Society for Studies of Cultural Heritage of Nicholas of Cusa“; federführender Organisator dieser russischen Cusanus-Gesellschaft ist Prof. Dr. Oleg Dushin. Tatsächlich hat das Bemühen um Cusanus eine lange Tradition in Russland, sie reicht bis in das 19. Jh. zurück. Ausgehend von der Rezeption cusanischen Denkens durch Schelling kam in ihr wesentlich die intellektmystische Haltung Nikolaus‘ von Kues zur Geltung, die für die – reformreligiös geprägte – neue russische Religionsphilosophie, die das Seelische des Menschen in den Mittelpunkt stellte, bedeutsam wurde. Auf je verschiedene Weise erläutern die hier vorgelegten Studien die gerade auch durch die Cusanus-Rezeption in Russland herausgearbeiteten religionsphilosophischen Gehalte im Werk des Nikolaus von Kues. Oleg Dushin stellt in seiner Arbeit die Cusanus und Nicholas Berdyaev gemeinsame Betonung der Kreativität als das maßgebliche Humanum heraus, das den Menschen zugleich als Abbild Gottes erscheinen lässt. Aleksandr Timofeev befasst sich mit dem religiösen Anteil in Hegels Lehre vom Menschen unter dem Blickwinkel des cusanischen Denkens. Henrieke Stahl deutet Losevs Interpretation der Intellektmystik des Cusanus, die von besonderer Bedeutung dadurch ist, dass Aleksej Losev mehrere Stränge der modernen Cusanus-Interpretation aufgreift und seine Aussagen auf eine gute Detailkenntnis des Cusanus stützen kann, da er einige Werke des Denkers selbst ins Russische übersetzte. Ergänzt werden diese ursprünglich russisch verfassten (und so in Verbum 15 (2013) veröffentlichten) Texte durch thematisch einschlägige weitere Arbeiten. Die Grundlage für das besondere Interesse der neuzeitlichen russischen Philosophen an Cusanus kommt in der Arbeit von Christiane Bacher zu Tage, die das Wechselverhältnis von Wissenschaft und Intellektmystik bei Nikolaus von Kues beschreibt. Dem gleichsam zur Seite tritt die Studie von Annette Hahn, die das cusanische Modell der koinzidentellen Struktur des Universums in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt, das wesentlich auf das russische religionsphilosophische Denken einwirkte. Nachdrücklich in den russischen Raum hinein wirkte dann – auch über seine ‚Schüler‘ Ernst Cassirer und Boris Pasternak – Hermann Cohen mit seiner neukantianisch getönten Religionsphilosophie, die Kirstin Zeyer im Hinblick auf ihre konkreten Folgen nachzeichnet: Cohens Eintreten für das Ostjudentum, das bis dahin weithin, auch im westlichen Judentum, als bloß rückständig galt. Gleichsam im Gegenzug erläutert Marion Rutz die Haltung von Cusanus gegenüber dem Judentum, dessen „Judendekret“ sie als Mittel im Bemühen um eine Reform der Christen deutet. Den Abschluss des Heftes bildet ein Überblick Klaus Reinhardts über Nikolaus von Kues in der neueren systematischen Theologie im deutschen Raum. Im Mittelpunkt stehen einerseits Karl Rahner und andererseits Hans Urs von Balthasar, letzterer zugleich ein Kenner der neuplatonisch getönten Theologie der Spätantike, die zu den Grundlagen des Denkens der russischen Orthodoxie gehört. In all diesen Arbeiten wird der Kontext der russischen Bemühungen um Cusanus deutlich, es ist gerade das spezifische der Welt und dem Menschen zugewandte, dabei doch durchweg religiös gegründete Denken des philosophischen Kardinals, das für die russische religiösen Denker von tragender Bedeutung war. Wolfgang Christian Schneider herausgegeben von Jörg Bernardy, Inigo Bocken Inhaltsverzeichnis I: Diskurse, Praktiken, Strategien, Taktiken II: Glaube, Subjekt, Selbstregierung, Freiheit Vorschau auf das kommende Heft Die Autoren Einführung herausgegeben von Kirstin Zeyer Inhaltsverzeichnis Buchbesprechungen Vorschau auf das kommende Heft Zu den Autoren Vorwort ZWISCHEN PHILOSOPHIE UND LITERATUR So verschieden sie auch auf den ersten Blick anmuten, Philosophie und Literatur sind doch eng verschränkt – nicht nur, weil beide wesentlich auf die Sprache zurückgreifen, sondern auch weil sowohl die Philosophie als auch die Literatur sich um ein Ordnen bemüht, Ordnungen aufsucht, Ordnungen herstellt, um so Sinn zu erzeugen oder sichtbar zu machen. Vor diesem Hintergrund sucht das vorliegende Heft der Coincidentia beispielhaft einzelne „Orte“ des Feldes zwischen Philosophie und Literatur zu betrachten. Im ersten Beitrag erörtert Eberhard Ortland das von Walter Benjamin beobachtete Zurückweichen der Metaphysik im Zuge der Aufklärung, sie wandert in die Mikrologie ein; gefordert ist darum ein „mikrologischer Blick“, der sich in die „minimalen Hohlräume“ im „unendlich Kleinen“ einnistet und das Vereinzelte freisetzt. Dies betätigt auf gewisse Weise der Beitrag von Claus-Artur Scheier über den Humor am Vorabend und am Morgen der industriellen Revolution, wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass der „tiefste Ernst“ des Humors der industriellen Moderne darin liegt, sich über dem offenen Abgrund in der Schwebe zu halten, indem er diese seine innerste Innerlichkeit verbirgt. Das in diesen Beiträgen Angerissene erhält in den Überlegungen von Detlef Thiel zur Rezeption von Eriugenas Vorstellung einer ignorantia Dei bei Cusanus, Schopenhauer und Mynona den tragenden Tenor: Jenes Nichtwissen, das zugleich ein unaussprechliches Verständnis ist, impliziert – trotz des Widerstrebens von Cusanus – ein umfassendes Zurücktreten bis hin zu einer schöpferischen Indifferenz. Diesem Text tritt Joachim Koppers Darlegung zum spekulativen Denken Meister Eckharts zur Seite; für diesen folgt die menschliche Seele ohne Rücksicht auf ihr Gegenwärtigsein in ihrem Denken über die Dinge Gott, der vor allen Dingen unabhängig von ihrem Bestehen wirke. Demgemäß sieht Kopper den Vollzug des spekulativen Gedankens von Meister Eckhart als ein Schweigen, das Hören ist. Philosophisch-literarische Bezüge anderer Art bringen die beiden folgenden Beiträge zum Ausdruck. Witalij Morosow behandelt mit Johann Sternhals‘ Ritter Krieg einen alchemistisch-philosophischen Text des 15. Jh.s, der mit seiner hermetischen Christologie einen selten behandelten, der mittelalterlichen Mystik entspringenden Traditionsstrang darstellt. Henrieke Stahl erläutert Cechovs Eine langweilige Geschichte als einen Schlüsseltext der literarischen Anthropologie des Dichters. Der Mensch wird als in reiner Aktivität sich selbst tragendes Ich sichtbar gemacht, das nicht Nichterkennen und Nichthandeln kann, sich in Erkennen und Handeln jedoch fremdbestimmen lassen und dadurch die Welt und sich selbst verfehlen kann. Die beiden anschliessenden Beiträge gelten dem lyrischen Sprechen. Wolfgang Christian Schneider weist für den Neuplatonismus Hölderlins unter anderem auf wenig beachtete neuplatonische Traditionslinien hin, insbesondere auf Gregor von Nyssa, dessen Göttlicher Pfeil in der Ausdeutung des Hohenliedes für Hölderlins Rede vom „anderen Pfeil“ in „Wie wenn am Feiertage…“ bedeutsam wird. Hölderlins Suche nach dem Göttlichen in der Natur antwortet aus dem 20. Jh. Paul van Ostaijen, der, wie Inigo Bocken herausarbeitet, mit seinem einsamen Bemühen um eine Rückkehr zum Ursprünglichen auf ähnliche Weise auf der Schwelle zum Unsagbaren steht. Der abschliessende Beitrag von Bernhard Schmalenbach erläutert die von Schillers Ästhetischen Briefen ausgehende Diskussion der pädagogischen und therapeutischen Bedeutung der Ästhetik. Allen diesen Beiträgen ist gemeinsam, dass sie auf den Kern des Philosophischen zurückgehen, in den Werken das Ringen um ein Verstehen und Selbstverstehen aufsuchen. Wolfgang Christian Schneider
Wolfgang Christian Schneider
zu § 17 innerhalb Kants Kritik der Urteilskraft
Marin Bunte
Zu Hölderlins ‚Patmos‘
Harald Schwaetzer
der symbolischen Formen.
Ernst Cassirer als Leser von Cusanus
José González Ríos
Claus-Artur Scheier
Thomas Schmaus
Heidegger liest George Korrektur
Ludwig Lehnen
Andrea De Santis
Der Halt der Orientierung
Werner Stegmaier
zur Philosophie der Orientierung
Lars Leeten
setzung, Kommentar v. Joachim Gruber. Berlin u.a. 2013
Detlef Thiel, Wiesbaden
Eine Propädeutik. Wiesbaden (2. Aufl.) 2012.
Kirstin Zeyer, Bernkastel-Kues
Philosophischen Anfangsgründe von Hölderlin, Schelling
und Hegel. Tübingen 2012.
Wolfgang Christian Schneider, Hildesheim
Band 4/1 – 2013
Cusanus:
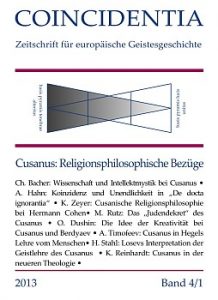 Religionsphilosophische Bezüge
Religionsphilosophische Bezüge
und Kirstin Zeyer
Wolfgang Christian Schneider
Christiane Bacher
Universums in „De docta ignorantia“ des Nikolaus von Kues
Annette Hahn
am Beispiel von Cohens Engagement für das ‚Ostjudentum‘
Kirstin Zeyer
Dokument im Bemühen um eine Reform der Christen
Marion Rutz
Kues und in der Religionsphilosophie des Nicholas Berdyaev
Oleg Dushin
in Hegels Lehre vom Menschen
Aleksandr Timofeev
Interpretation der Geistlehre des Cusanus
Henrieke Stahl
Klaus Reinhardt
des Nikolaus von Kues. Debatten und Rezeptionen.
Bielefeld 2013
Susann Kabisch, Hildesheim
Pythagoras and Renaissance Europe. Cambridge 2009
Harald Schwaetzer, Alfter
Harald Schwaetzer, Alfter
Antike bis zum 18. Jahrhundert. Köln u.a. 2011
Harald Schwaetzer, Alfter
und Judentum von Cohen bis Lévinas. Heidelberg 2011
Kirstin Zeyer, Bernkastel-Kues
Kirstin Zeyer, Bernkastel-Kues
materialistische neodarwinistische Konzeption der Natur
so gut wie sicher falsch ist. Berlin 2013
Christoph Hueck, Tübingen
Band 3/2 – 2012
Michel Foucault
 und
und
Michel de Certeau
– Diskursive Praktiken
und Wolfgang Christian Schneider
Jörg Bernardy, Inigo Bocken, Wolfgang Christian Schneider
Michel Foucault in der Kritik von Michel de Certeau
Marian Füssel
Frieder Vogelmann
bei Michel de Certeau im Hinblick auf Michel Foucault
Inigo Bocken
wider die Kritik von Michel de Certeau
Jörg Bernardy
nach Michel de Certeau
Lars Leeten
Produktionslogik und Handlungsvollzug
bei Michel de Certeau und Michel Foucault
Daniel-Pascal Zorn
Annäherung an das Werk von Michel de Certeau
Manfred Zmy
of God as Veritable Critique of the Anthropological Illusion
Roberto Nigro
Theory of Christianity
Marc de Kesel
Handlungsspielraum jenseits von Certeau und Foucault
Wim Weymans
und zurück – Disziplinarmacht und Parrhesia
bei Michel Foucault
Hans-Martin Schönherr-Mann
Volker Caysa
Jörg Bernardy, Inigo Bocken, Wolfgang Christian Schneider
Band 3/1 – 2012
Zwischen
 Philosophie und Literatur
Philosophie und Literatur
und Wolfgang Ch. Schneider
Wolfgang Christian Schneider
musikalische Erfahrung bei Adorno
Eberhard Ortland
Von Sterne zu De Quincey
Claus-Artur Scheier
des Eriugena bei Cusanus, Schopenhauer und Friedlaender/Mynona
Detlef Thiel
Zum spekulativen Denken Meister Eckharts
Joachim Kopper
Witalij Morosow
Anton Cechovs realistisch-personalistische Anthropologie am Beispiel
der Erzählung Skucnaja istorija (Eine langweilige Geschichte) (1889)
Henrieke Stahl
Neuplatonische Spuren in Hölderlins Gedicht Wie wenn am Feiertage…
Wolfgang Christian Schneider
Das Gedicht Sous les ponts de Paris
Inigo Bocken
Bernhard Schmalenbach
Schelling, Nietzsche, Kant. Freiburg / München 2011
Bruno Pieger, Kleines Wiesental
Indifferenz; hg. u. eingeleitet v. Detlef Thiel. (Gesammelte Schriften
Bd. 10, hg. in Zusammenarbeit mit der Kant-Forschungsstelle der
Universität Trier v. Hartmut Geerken u. Detlef Thiel.)
Kirstin Zeyer, Bernkastel-Kues
Renovatio et unitas – Nikolaus von Kues als Reformer. Theorie
und Praxis der reformatio im 15. Jahrhundert. Göttingen 2012
Sussan Kabisch, Hildesheim
